Guten Abend, liebe SABA-Freunde und Liebhaber jedweder Audio- und Video-Geräte,
beim Studium von alten Zeitschriften fallen mir immer wieder Artikel auf, die man auf den ersten Blick nicht eindeutig zuordnen kann, die aber für manchen von uns - vor allem für die, die sich mit der Geschichte der einzelnen Hersteller beschäftigen - von Interesse sein können. Diese Artikel möchte ich in loser Folge hier einstellen, vorausgesetzt, es besteht Interesse daran. Falls das nicht die richtige Rubrik dafür ist, oder aus Gründen des besseren Auffindens eine andere Überschrift sinnvoll ist, können die Admins das natürlich ändern. Danke im voraus und viel Spaß beim Lesen.
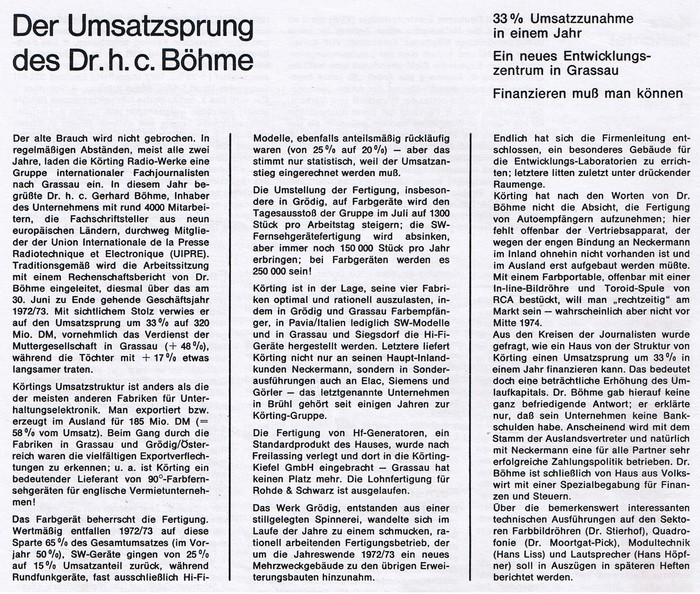
Quelle: Funkschau Heft Nr. 14/1973
Viele Grüße aus Köln am Rhein von Klaus.
beim Studium von alten Zeitschriften fallen mir immer wieder Artikel auf, die man auf den ersten Blick nicht eindeutig zuordnen kann, die aber für manchen von uns - vor allem für die, die sich mit der Geschichte der einzelnen Hersteller beschäftigen - von Interesse sein können. Diese Artikel möchte ich in loser Folge hier einstellen, vorausgesetzt, es besteht Interesse daran. Falls das nicht die richtige Rubrik dafür ist, oder aus Gründen des besseren Auffindens eine andere Überschrift sinnvoll ist, können die Admins das natürlich ändern. Danke im voraus und viel Spaß beim Lesen.
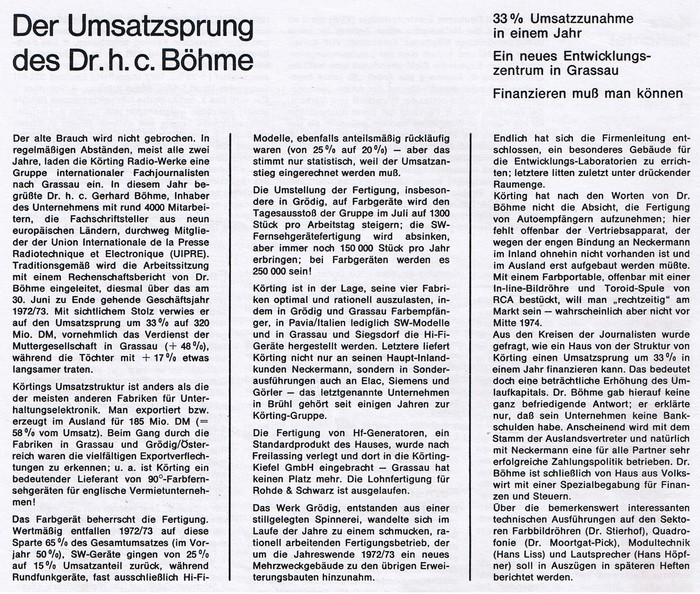
Quelle: Funkschau Heft Nr. 14/1973
Viele Grüße aus Köln am Rhein von Klaus.

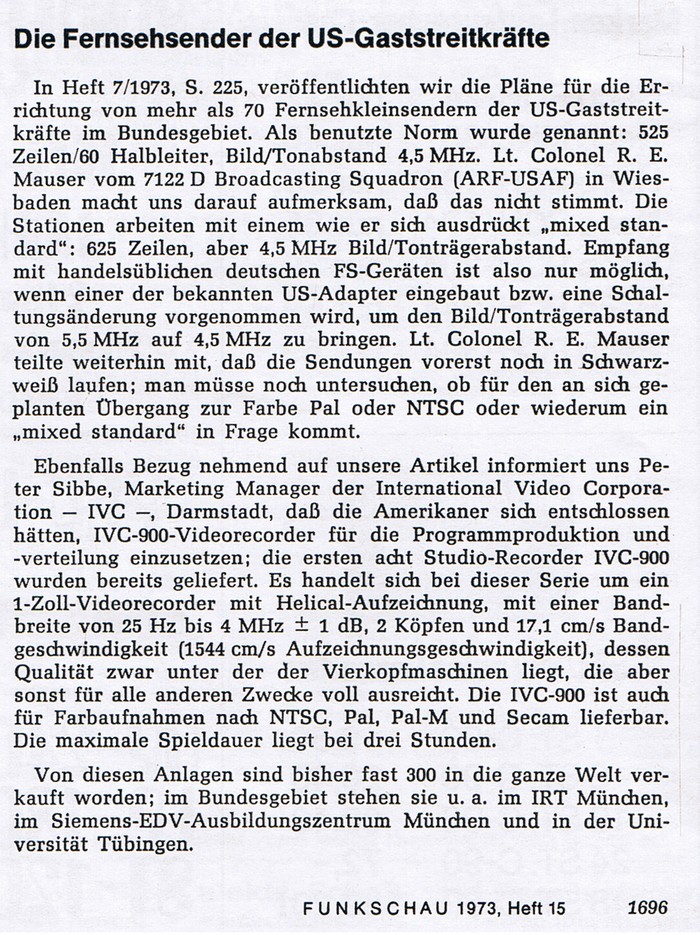
 An Radiosendern übriggeblieben ist doch wohl BFBS Radio 1 und 2 und das in der ganzen Englischen Zone.
An Radiosendern übriggeblieben ist doch wohl BFBS Radio 1 und 2 und das in der ganzen Englischen Zone.
