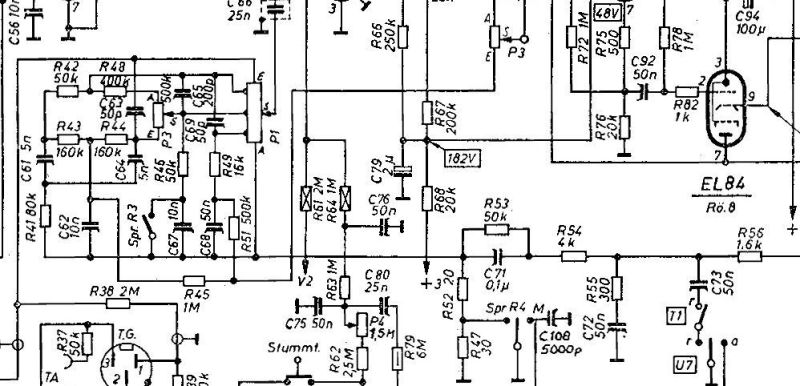Mit mangelhaften Klangeigenschaften hatte ich auch schon bei unterschiedlichen Geräten und Fabrikaten wiederholt Probleme, besonders mit der Basswiedergabe im mittleren Lautstärkebereich.
Erstmals ging ich der Sache bei einem Tannhäuser (Nordmende) auf den Grund, denn da reagierte fast nichts mehr vernünftig, die "Klangtasten" besonders die Bass-Taste zeigte kaum Wirkung, der Klang war einfach "dünn".
Nach Überprüfen aller Bauteile in den NF-Stufen, welche beste Werte aufwiesen, wollte ich die Kiste schon "ermorden". Da kam mir der Gedanke einmal das Lautstärkepoti mit seinen vielen (3) Anzapfungen etwas näher zu betrachten. Dabei stellte sich dann heraus, dass zwei dieser Anzapfungen in der "Luft" hingen. Daraufhin zerlegte ich das Poti und stellte fest, dass die Nietverbindungen der Anzapfungen zur Kohlebahn keinen Kontakt mehr hatten; in Eile baute ich dann die Nieten aus... seitdem suche ich nach 2mm Hohlnieten.
Einen Tag später kam ein Kumpel mit seinem Rigoletto (auch NM) zu mir und klagte über wenig Bass usw. Und auch in diesem Falle hingen die Anzapfungen in der Luft. Diesmal zerlegte ich das Poti auch, aber ich ließ die Nieten in Ruhe, dafür trug ich etwas Leitsilber rings um die Niete auf und schon war der Kontakt wiederhergestellt - Poti eingebaut - Super Klang mit sattem Bassanteil.
Nun erinnerte ich mich an meinen Freiburg, welchen ich wegen seines schmalen Klanges in die Ecke verbannt hatte. Und auch hier erwies sich die Kontaktierung der Anzapfungen mangelhaft. Also: Poti ausgebaut, zerlegt, Leitsilber aufgetupft... Gerät eingeschltet und - volles Basspotential!
Vielleicht mal nach den Anzapfungen schaun...
Gruß, Peter.
Man kann das gut messen wenn man das Ohmmeter zwischen Schleifer und Anzapfung anschließt, dann am Poti drehen - sofern der Schleifer in den Bereich der entsprechenden Anzapfung kommt muss ein Widerstandsminimum erreicht werden, welches im niedrigen Ohmbereich (<100 Ohm) liegen sollte.
Zu dieser Messung braucht das Poti nicht ausgebaut werden - es kann auch angeschlossen bleiben.
Erstmals ging ich der Sache bei einem Tannhäuser (Nordmende) auf den Grund, denn da reagierte fast nichts mehr vernünftig, die "Klangtasten" besonders die Bass-Taste zeigte kaum Wirkung, der Klang war einfach "dünn".
Nach Überprüfen aller Bauteile in den NF-Stufen, welche beste Werte aufwiesen, wollte ich die Kiste schon "ermorden". Da kam mir der Gedanke einmal das Lautstärkepoti mit seinen vielen (3) Anzapfungen etwas näher zu betrachten. Dabei stellte sich dann heraus, dass zwei dieser Anzapfungen in der "Luft" hingen. Daraufhin zerlegte ich das Poti und stellte fest, dass die Nietverbindungen der Anzapfungen zur Kohlebahn keinen Kontakt mehr hatten; in Eile baute ich dann die Nieten aus... seitdem suche ich nach 2mm Hohlnieten.
Einen Tag später kam ein Kumpel mit seinem Rigoletto (auch NM) zu mir und klagte über wenig Bass usw. Und auch in diesem Falle hingen die Anzapfungen in der Luft. Diesmal zerlegte ich das Poti auch, aber ich ließ die Nieten in Ruhe, dafür trug ich etwas Leitsilber rings um die Niete auf und schon war der Kontakt wiederhergestellt - Poti eingebaut - Super Klang mit sattem Bassanteil.
Nun erinnerte ich mich an meinen Freiburg, welchen ich wegen seines schmalen Klanges in die Ecke verbannt hatte. Und auch hier erwies sich die Kontaktierung der Anzapfungen mangelhaft. Also: Poti ausgebaut, zerlegt, Leitsilber aufgetupft... Gerät eingeschltet und - volles Basspotential!
Vielleicht mal nach den Anzapfungen schaun...
Gruß, Peter.
Man kann das gut messen wenn man das Ohmmeter zwischen Schleifer und Anzapfung anschließt, dann am Poti drehen - sofern der Schleifer in den Bereich der entsprechenden Anzapfung kommt muss ein Widerstandsminimum erreicht werden, welches im niedrigen Ohmbereich (<100 Ohm) liegen sollte.
Zu dieser Messung braucht das Poti nicht ausgebaut werden - es kann auch angeschlossen bleiben.
Freundliche Grüsse, sagnix